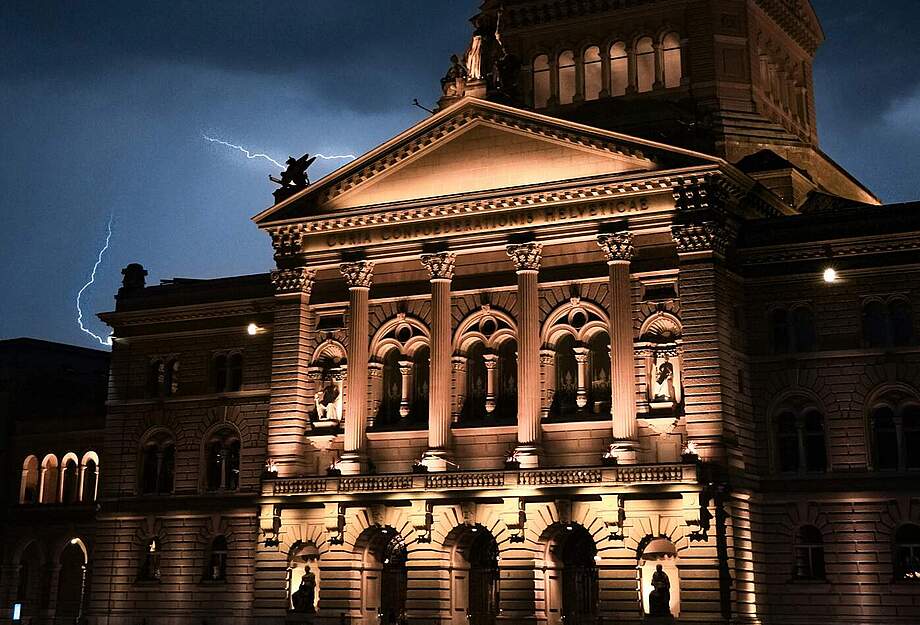Bundesrat und Parlament sind schon länger auf Sparkurs. Finanzpolitisch ist dieser unnötig, volkswirtschaftlich falsch und für die Bevölkerung und das Bundespersonal eine Zumutung. Noch mehr gilt dies für das vom Bundesrat präsentierte «Entlastungspaket 2027». Die Gewerkschaften werden sich vehement dagegen einsetzen.
Bürgerlicher Interpretationsspielraum
Gemäss Maastricht-Kriterien weist die öffentliche Hand in der Schweiz eine Nettoschuldenquote von 25 Prozent auf, in Deutschland sind es 65 Prozent. Die kommende, bürgerlich dominierte deutsche Regierung hat vor Kurzem vorab beschlossen, parallel zum engen Korsett der Schuldenbremse ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro zu schaffen. Die zweifelsfrei ebenfalls bürgerlich dominierte Schweizer Regierung wiederum beharrt auf einem harten Sparkurs und plant mit dem «Entlastungspaket 2027» (zusätzliche) jährliche Einsparungen von über 3 Milliarden Franken. Zum Vergleich: Wollte man in der Schweiz mit gleichen Ambitionen wie Deutschland in die Zukunft investieren, ergäbe dies im Verhältnis zur Wirtschaftsgrösse einen Betrag von ziemlich genau 100 Milliarden Franken. Damit liesse sich eine Menge anfangen: Die Versäumnisse bei der Energiewende mit einem substanziellen öffentlichen Investitionsprogramm korrigieren; den horrenden inländischen Personalmangel im Gesundheits- und Pflegesektor mit einer Bildungs- und Lohnoffensive beheben; die völlig unsozial finanzierte Krankenpflegeversicherung auf eine solidarische Finanzierungsbasis stellen; den frappanten Digitalisierungsrückstand weit über die öffentliche Verwaltung hinaus aufholen etc.
Sparkurs Hypothek für künftige Generationen
Deutschland wird sich sein Sondervermögen leisten können, weil es dazu für eine gut funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft schlicht keine Alternative gibt. Man denke nur etwa an den Investitionsrückstand in der Schieneninfrastruktur, welche die vergangenen Generationen den heutigen und künftigen hinterlassen haben (um in den Worten der VerfechterInnen der Schuldenbremse zu sprechen). Wenn es Deutschland kann, könnte es natürlich auch die Schweiz – siehe Maastricht-Vergleich zu Beginn. Doch zumindest könnte, ja müsste die Schweiz dringend vom eingeschlagenen Sparkurs abrücken. Denn dieser ist finanzpolitisch unnötig, volkswirtschaftlich völlig falsch und für die Bevölkerung eine Zumutung.
Die Hauptprobleme der Schweizer Finanzpolitik sind nicht Schulden und Defizite, sondern Überschüsse und ein Vermögensaufbau des Staates auf Kosten der Privathaushalte und Sozialversicherungen. Die Kehrseiten dieser Politik sind einerseits ein anhaltender Kaufkraftverlust breiter Bevölkerungsschichten und andererseits eine Unterfinanzierung (bzw. ungerechte Finanzierung) öffentlicher Investitionen und Dienstleistungen.
Sparpaket nur schon buchhalterisch unnötig
Mittlerweile verfügen Bund, Kantone und Gemeinden über ein Eigenkapital von über 120 Milliarden Franken. Nötig wäre deshalb zuallererst eine verfassungskonforme Anpassung der Schuldenbremse, dahingehend dass der Bund künftig so viel ausgeben kann, wie er einnimmt, anstatt strukturelle Überschüsse zu machen, die jeweils unproduktiv «auf der hohen Kante» landen. Diese Überschüsse entstehen chronisch einerseits durch Einnahmenunterschätzungen und andererseits durch Ausgabenunterschreitungen. Zusammen genommen betrugen diese Abweichungen während der Jahre 2005-2021 im Durchschnitt jeweils 2.1 Milliarden Franken, im neusten Rechnungsjahr 2024 waren es sogar 2.7 Milliarden Franken. Die interessante Parallele zu dieser Zahl: Sie entspricht exakt dem vom Bundesrat für das Jahr 2027 beabsichtigte zusätzliche Sparvolumen von 2.7 Milliarden Franken. Das heisst, dass allein die langfristigen jährlichen Budgetabweichungen die geplanten Sparmassnahmen fast schon obsolet machen.
Finanzpolitik schon lange schwer verdaulich
Das vom Bundesrat in die Vernehmlassung gegebene Sparpaket ist wie erwähnt keineswegs der Auftakt, sondern quasi der Hauptgang eines unappetitlichen Menüs mit bereits vielen vorangegangenen ungeniessbaren Vorspeisen – davon hier nur eine Auswahl: Für 2024 und 2025 wurden und werden massive «Querschnittskürzungen» umgesetzt, die Mittel des Bundes für die Arbeitslosenversicherung wurden gekürzt und beim Bundespersonal sowie insbesondere der Entwicklungshilfe müssen zugunsten der strategielosen massiven Aufstockung der Armeeausgaben radikale Kürzungen verkraftet werden. Und nun eben die Hauptspeise: Sparen bei der AHV und bei den Prämienverbilligungen, Erhöhung der öV-Billettpreise und der Studiengebühren, finanzpolitische Aushöhlung der Klimaziele, starke Schwächung von Bildung und Forschung, weitere Kürzungen beim Personal etc. Die gesamte Liste der 59 Massnahmen ist viel zu lang.
Kürzungen kurz- und langfristig spürbar
Der Schaden, den die Sparpolitik bereits anrichtet und – käme dieses Sparpaket so durch – zusätzlich anrichten würde, ist auf vielen Ebenen spürbar. Einerseits sehr direkt und kurzfristig. Kürzt der Bund beispielsweise seine Beiträge an die ETHs, Unis und Fachhochschulen, dann werden ganz einfach die Studiengebühren verdoppelt (davon geht der Bundesrat selbst aus). Die direkte Folge: Die soziale Selektion in der Hochschulbildung nimmt weiter zu und damit langfristig auch der Fachkräftemangel. Indirekt und langfristig werden vor allem die Auswirkungen jener Einschnitte spürbar sein, die ausserhalb des Bundeshaushalts geplant sind, z.B. bei den Einlagen in den Bahninfrastrukturfonds: Werden diese wie geplant um 200 Millionen jährlich reduziert, passiert heute nicht viel. Irgendwann ist dann aber vielleicht das Schienennetz marode und jeder zweite Zug fährt mit Verspätung. Deutsche Reisende in der Schweiz – und damit zurück zum Ausgangspunkt dieses Artikels – würden sich dann erstaunt an den Zustand der Deutschen Bahn heute zurückerinnert fühlen. Es wäre eine absolute Dummheit, wenn wir es so weit kommen liessen.
Die Gewerkschaften werden sich deshalb weiter mit aller Kraft gegen die schädliche Sparpolitik einsetzen.